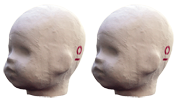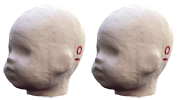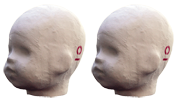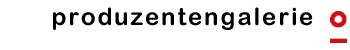installation
2014
warumnICHt
ATELIER MUSEUM HAUS LUDWIG, saarlouis

Eröffnungsrede von Dr. Verena Paul am 10.08.2014
»Ich habe angefangen die Kunstbevölkerung zu schaffen, weil ich Menschen kenne.« So äußerte Peter Köcher sich einmal über seine lebensgroßen Figuren, die mittels Schläuchen untereinander verbunden sind oder aber an allen nur denkbaren Stätten angedockt werden können: an Mauerwerk, Einkaufswägen, Hochspannungsisolatoren, Baumstämmen, an eigens für sie geschaffenen Auftankstationen oder ganz einfach am Boden. Insofern unterliegt die Interaktion zwischen den Körpern und ihrer Umgebung einer konstanten Neuauslotung. Allerdings steht für Peter Köcher nicht diese Wechselwirkung zwischen Objekt und Raum im Zentrum, sondern, wie er sagt, die »Ästhetik der zwischenmenschlichen Beziehungen«.
In Korrespondenz mit der leicht aufgerauten Epidermis der Plastiken, die aus medizinischen Mullbinden besteht, rücken seelische Verletzungen sowie die sich anschließenden Heilungsprozesse in den Fokus: Den versehrten Leibern soll Schutz und Wärme zuteil werden. Dergestalt verlieren die skulpturalen Arbeiten ihren von vielen Betrachtern wahrgenommenen negativen Impetus, da sowohl die Schläuche, die aus Knien, Armstümpfen, Schultern oder Händen heraustreten, als auch die roten Zahlenreihen und Symbole die Entindividualisierung des Menschen nur diagnostisch festhalten, jedoch keine endgültige Klassifizierung vornehmen. Durch Einprägung von schlichten Codes in der Figurenhaut, die Namen und sonstige individuelle Merkmale überflüssig erscheinen lassen, avancieren die klonartigen Gestalten zu neutralen Beobachtern und bilden schließlich einen wichtigen Gradmesser für gesellschaftliche Entwicklungen. Indem sich Peter Köchers Kunstbevölkerung in keiner Beziehung festlegen lässt, sich konstant weiterentwickelt, nach Orten sucht, die sie verzaubern oder entzaubern, stärken oder entkräften kann, nimmt sie Einfluss auf ihr Umfeld.
Ein wunderbares Beispiel dieser Einflussnahme finden Sie im ersten Ausstellungsraum: Die »Schöne«, deren rechte Hand an einem Hochspannungsisolator angedockt ist, offeriert uns einen anschlussbereiten Schlauch. Diese Figur ist eine der wenigen weißen Schattenwesen der Kunstbevölkerung, deren Korpus keine Amputationen aufweist. Allerdings ist die Haut ihrer linken Schulter aufgerissen, was als ästhetische Bruchstelle des makellosen Frauenleibs gedeutet werden kann. Grazil und elegant steht sie in feuerroten Stiefeletten vor uns und scheint gleichzeitig aus dem Korsett ihrer unnahbaren Schönheit ausbrechen zu wollen. Gefangen in einem scheinbar perfekt proportionierten Körper und erfüllt von Energie sucht sie die Nähe zu ihrem Gegenüber – und vermag doch nicht die unsichtbare Wand zu durchbrechen.
Doch die hiesige Ausstellung erzählt nicht nur von entrückten Kunstgestalten, sondern auch vom Sonderstatus des gebärenden männlichen Geschlechts sowie von der Sprengsätzigkeit, die sich im »Schläfer« manifestiert. Es ist ein drastischer Kippmoment zwischen Ästhetik und abgründiger Tiefe, den wir hier beobachten können. Dominiert zunächst der maskuline, in stabiler Seitenlage positionierte Leib, dessen Glieder in einer mehr oder weniger verrenkten Bewegung eingefroren sind, erregt schon bald der Benzinkanister unsere Aufmerksamkeit, auf dem das Haupt der Figur gebettet ist. Dieses Utensil macht die Situation des Schlafenden lebensbedrohlich. Auch das vor ihm sitzende Baby ist in das Vabanquespiel eingebunden. Einzig die vom Meerwasser geformten Gebilde aus Seegraswurzeln, die um die kleine Gruppe verstreut liegen, scheinen für kurze Augenblicke dem Gefahrenpotenzial die Wirkkraft der Natur entgegenzuhalten.
Getragen wird die unheilschwangere Situation außerdem von den 35 an Sprungfedern befestigten Babyköpfen des benachbarten Wandobjekts. Gereiht blicken uns die kleinen Gesichter aus verschatteten Augenhöhlen entgegen: verdinglicht und geistlos. Einzig die metallenen Federn suggerieren so etwas wie eine Entwicklungschance, die jedoch im selben Moment von dem auf dem Boden liegenden Köpfchen infrage gestellt wird. Denn im Gegensatz zum matten Weiß seiner Verwandten weist dieser Schädel ein glänzendes Inkarnat auf, sodass es im rigiden System der Anpassung durch das Raster fallen musste. Peter Köcher öffnet damit ein großes Feld für Assoziationen, die von persönlichen Erfahrungen der Betrachter bis hin zum Entdecken gesellschaftlicher Schieflagen reichen können.
Mit der großformatigen Mixed-Media-Arbeit, die sich an der gegenüberliegenden Wand befindet, scheint der Künstler eine Antwort auf das genormte, in sich erstarrte Ordnungsgefüge der »Sprungfedern« gefunden zu haben: Der Aufbruch in eine dynamische Formensprache sowie eine experimentierfreudige Materialerkundung. Hier gibt es kein Halten mehr. Die Leinwand saugt alles auf: Teile eines Bettbezugs, viele Acrylschichten, Sprühlack sowie Ölkreide, mit der Peter Köcher Kreise zieht, Kreuze errichtet, schwungvolle Häkchen macht, den drei Zahlenreihen mit Strichen Grenzen setzt und schreibt – zumeist unleserlich, aber ein Wort prägt sich unserer Netzhaut doch ein: ›morgen‹. Wie bedroht ist die Zukunft? Ist sie vielleicht schon abgehakt oder gar zu Grabe getragen worden? Oder führt Peter Köcher uns hier nicht vielmehr ein Schreckensszenario vor Augen, das noch abgewendet werden kann? Immerhin ist der bekennende Provokateur bei all seinen zeitkritischen und nachdenklich stimmenden Werken ein feinsinniger Optimist geblieben.
Geradezu angriffslustig zeigt sich Peter Köcher unter anderem mit seiner Frage, ob ein reines Gewissen ein sanftes ›silverkissen‹ ist? Oder berührt die 2012 entstandene Werkreihe nicht vielmehr einen empfindlichen Punkt in einer zusehends substanzlos werdenden, markenorientierten Gesellschaft? Es erstaunt daher nicht, dass der Künstler sich bei den mit Flüssigkeit gefüllten silbernen Kissen einen berühmten geistigen Vater zum Vorbild wählte: Den amerikanischen Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Während dessen »Silver Clouds« unbeschwert in der Luft tanzten, kippen die »silverkissen« Peter Köchers bei Berührung um und schaukeln am Boden hin und her. Trotz ihrer Verspieltheit und Simplizität formulieren beide Serien allerdings eine harsche Kritik an eben jener gedankenlosen Wegwerfgesellschaft, die von der spiegelnden Haut der Objekte eingefangen wird. Dementsprechend bieten die »silverkissen« nur dann ein sanftes Ruhekissen, wenn eine kritische Auseinandersetzung und ein substanzielles Umdenken vorausgegangen sind.
Ein Blick auf das Werk »Kunst der Vergangenheit« genügt, um zu verstehen, wie komplex die Arbeit angelegt ist und wie viel Aussagepotenzial darin verborgen liegt. Die Aufschrift ›KUNST DER VERGANGENHEIT‹, die sich in weißen Lettern über den schwarz-weiß-roten, partiell aufgerissenen Bildgrund erstreckt, wirft wichtige Fragen auf: Welchen Stellenwert besitzt die Kunst der Vergangenheit? Können Kunstschaffende in der Postmoderne und unter der Last der Tradition überhaupt noch Kunst hervorbringen oder nimmt aktuelle Kunst gar selbstbewusst das Erbe vergangener Epochen in sich auf? Mit diesen Vorüberlegungen wird der Einstieg in eine zerbrechliche, geheimnisvoll tiefgründige Bildwelt ermöglicht, in der weiße Babyköpfe beinahe behutsam in ein Netz aus Schnüren gespannt sind und damit ein heilsames Gegengewicht zu den Köpfchen auf den Sprungfedern bilden.
Neben den Werken, die das Menschsein in einer schnelllebigen Zeit ungeschönt durchleuchten, experimentiert Peter Köcher gerne und viel mit Materialien. Da sind beispielsweise die Styroporarbeiten, die sich durch ihre zerklüfteten, farblich dezenten Kraterlandschaften auszeichnen oder die schwarzen MDF-Platten mit dem verbrannten Kunstsoff. Hier dominieren biomorphe Oberflächenstrukturen sowie das leuchtende Blau, das einen spannenden Dialog mit dem Rot der Verschlüsse von elf Plastikflaschen führt, die auf dem Boden positioniert sind.
Im letzten Raum der Ausstellung dann verschließt Peter Köcher der allzu vorlauten Buntheit seiner zwölfteiligen Werkserie mittels Bitumen den Mund. Denn Farben erscheinen im Werk des Künstlers nur in wohl dosierter Form, wie auch die großformatige, in Schwarz, Weiß und Rot gestaltete Arbeit mit dem 13 Mal eingeprägten Wort ›ICH‹ zu erkennen gibt. Die vertikal mehrfach aufgerissene Objekthaut klafft auseinander und gibt den Blick auf eine mystische Welt frei, die das ›ICH‹ jederzeit mit sich in die Tiefe reißen kann. Wie der Titel dieser Ausstellung bereits zu erkennen gibt, spielt Peter Köcher gerne mit seinem Alter Ego. Mit der Frage »Warum nicht?« sucht der Künstler nach Grenzüberschreitungen, nach neuen Wegen, um Kunst Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Und mit der Frage »Warum nicht ich?« scheint das Künstler-Ich allen Mut zusammenzunehmen und sich dieser Aufgabe anzunehmen, denn Kunst braucht einen engagierten Fürsprecher. Es braucht einen Künstler, der sich für eine Performance auf die Straße begibt und um »ein paar Cent als Hilfe zum Leben« bittet, diese Kunstaktion dann auf Karten dokumentiert und schließlich in Gerhard-Richter-Manier mit kräftigen Spachtelzügen überarbeitet, sodass die Botschaft umso deutlicher hervortreten kann. Jene Karten, die ebenfalls im letzten Raum präsentiert werden, gehören zu Peter Köchers schweigsameren Arbeiten und doch zeigen sie den Wesenskern seines Kunstverständnisses: Das Aufspüren und Einfangen von Janusköpfigkeit. Insofern wünsche ich Ihnen nun viel Freude beim Entdecken dieser vielschichtigen Werke!